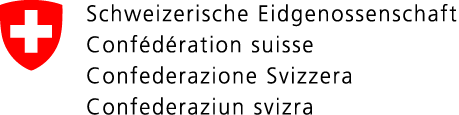2021 führte Innosuisse die Flagship-Initiative ein. Mit dieser Förderinitiative will die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung systemische und transdisziplinäre Innovationen ankurbeln, die für die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der Schweiz zentral sind.
Erfahren Sie mehr über die laufenden Flagship-Projekte:
Ausschreibung 2023: Disruptive Lösungen für die Transition zu einer Netto-Null-Welt
Das Ziel des Projektes Circulus ist es, die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallverarbeitende (MEM) Industrie über die Unternehmensgrenzen hinweg in ein kreislauffähiges System zu transformieren, in welchem jedes Abfallprodukt Input für einen nächsten Lebenszyklus ist. Somit wird kein der Natur entnommenes Material nach der Nutzungsphase des Produktes mehr verloren gehen, sondern alles wird in gleichem oder anderem Anwendungszweck weiterverwendet. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Produkte und ihre Komponenten kreislauffähig werden und dies in Einklang mit ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeitszielen. Letztendlich ist das Ziel, die gesamte MEM-Industrie in ihrer Transformation zu einer Netto Null-Industrie zu unterstützen. Dies zum Wohle unseres Planeten, unserer Bevölkerung und dem nachhaltigen Fortbestand unserer Unternehmen.
In einem Kontext, der sowohl von der Notwendigkeit geprägt ist, verfügbare Grundstücksflächen zu sparen, als auch von der Dringlichkeit des ökologischen Wandels, verfolgt das SwissRenov-Projekt zwei komplementäre Ziele: Entwicklung einer Methode zur Aufwertung von Industriebrachen, die den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen entspricht, und wirtschaftliche Aufwertung aller im Kanton Jura vorhandenen Brachen.
Das erste Ziel stützt sich auf eine Partnerschaft mit den Eigentümern von drei wichtigen Industriebrachen im Jura. Das zweite Ziel besteht darin, ein Inventar von Brachflächen zu erstellen, die Hindernisse für ihre wirtschaftliche Nutzung zu ermitteln, den Bedarf an Immobilien- und Grundstücksressourcen zu verstehen und dann Schnittstellen zu entwerfen, um das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage nach Flächen zu erleichtern.
Die Energiespeicherung ist entscheidend für den Übergang zu einer 100%igen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Einsatzmöglichkeiten von Energiespeichern sind vielfältig und hängen von den Betreibern ab, die je nach ihren Bedürfnissen und Geschäftsmodellen in sie investieren werden. Die Energiespeicherung könnte sich zwar spontan weiterentwickeln, aber es gibt keinerlei Gewähr dafür, dass diese spontane Entwicklung auch tatsächlich funktioniert, um eine hunderprozentige erneuerbare Produktion zu erreichen. Beispielsweise bieten Batterien allein möglicherweise nicht genügend Speicherkapazität, um saisonale Schwankungen bei den erneuerbaren Energien auszugleichen, die Power-to-Gas-Technologie reicht möglicherweise nicht aus, um einen schnellen Netzausgleich zu erreichen, und ungünstig gelegene Energiespeicher unterstützen möglicherweise nicht die Integration der Photovoltaik in die Verteilungsnetze. STORE gibt einen Überblick über die wichtigsten Anwendungsfälle von Energiespeichern und liefert Betreibern die Werkzeuge für die Planung und den Betrieb von Speicherressourcen. Im Sinne eines systemischen Ansatzes untersucht STORE, wie diese Anwendungsfälle zu einer Energiespeicherinfrastruktur beitragen werden, um eine 100%ige erneuerbare Produktion und Versorgungssicherheit in der Schweiz zu erreichen.
Das Innosuisse-Flaggschiffprojekt «Regeneratives Bauen «Think Earth"" erweitert traditionelle Bautechniken und Erfahrungen mit Holz und erdgebundenen Materialien auf ressourcenschonende und kreislauforientierte Weise. Das Projekt ist in drei Hauptphasen gegliedert, die zehn voneinander abhängige Teilprojekte umfassen, die in einem breiten Spektrum von Massstäben arbeiten: Von der Materialwissenschaft und den Verfahren bis hin zu Prototypen für den Hochbau in Originalgrösse sowie Fallstudien und Normen für die Architektur.
Durch die Kombination von Holz und Erde als komplementäre Baumaterialien (1+1=3) in Verbindung mit effizienten und skalierbaren Konstruktionsmethoden kann ein bedeutender Beitrag zum klimaneutralen, erneuerbaren Bauen und Wohnen geleistet werden.
Das Projekt GreenHub soll aufzeigen, wie die Energieautarkie der Schweiz erhöht werden kann. Dies soll durch die intelligente Nutzung von Synergien zwischen verschiedenen Technologien erreicht werden, etwa durch die Umwandlung von lokal erzeugter Wärme, CO2 und Strom in chemisch speicherbare Energieträger. Ziel ist es, die Winterstromlücke von 9 TWh zu schliessen und damit die Energieversorgung der Schweiz ganzjährig sicherzustellen. Dies wird auf regionaler Ebene durch die Einrichtung eines Green Energy Hub demonstriert.
Die KVA Horgen dient als Reallabor und ist als Umsetzungspartner massgeblich in das Projekt eingebunden. Ein wesentlicher Teil der Forschungsergebnisse aus dem vierjährigen Projekt wird in Horgen anhand von Prototypen im Echtbetrieb getestet und auf ihre Skalierbarkeit für andere Abfallverwertungs- und Industrieanlagen geprüft. Während der Projektlaufzeit werden auch Führungen vor Ort angeboten, um der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in die Forschungsergebnisse und das Potenzial von Green Energy Hubs für eine nachhaltige Energieversorgung zu geben.
Die Substitution fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien erfordert einen massiven Ausbau der saisonalen Energiespeicherung. Die saisonale thermische Energiespeicherung (STES) kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Bisher wurde das Potenzial dieser Technologie weitgehend übersehen, obwohl sie einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe, zur Maximierung der Integration von erneuerbaren Energien und Abwärme, zur Senkung des Spitzenbedarfs und zur Schliessung der Stromlücke in den Wintermonaten leisten könnte. Mit dem Flaggschiffprojekt SwissSTES wird dieses Problem angegangen, indem STES-Möglichkeiten wie Hohlräume, Aquifere und unterirdische Reservoirs holistisch untersucht werden. Im Rahmen des Projekts werden neue Technologien vorgestellt sowie ein Aktions- und Umsetzungsplan für die Schweiz erarbeitet, um STES als nachhaltiges und skalierbares Konzept zu etablieren. Zusammen mit der Industrie werden neue Produkte, unternehmerische Ökosysteme, rechtliche Rahmenbedingungen und gesellschaftspolitische Massnahmen entwickelt. Regionale Fallstudien ebnen den Weg für landesweite Pilot- und Demonstrationsprojekte.
SWIRCULAR wird von einem Konsortium aus Schweizer Forschungsinstitutionen und Industriepartnern durchgeführt, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Umgestaltung der Schweizer Bauindustrie durch die Nutzung zirkulärer Verfahren. Das Konsortium bietet eine breite Palette an Know-how und erstreckt sich über alle Phasen des Lebenszyklus. So wird sichergestellt, dass Innovationen im Bereich des kreislauforientierten Bauwesens effektiv entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden.
Die Struktur des Projekts ist eine Antwort auf den dringenden Bedarf an einem koordinierten und standardisierten Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft im Bausektor, der speziell auf den Schweizer Kontext zugeschnitten ist. SWIRCULAR besteht aus acht miteinander verknüpften Teilprojekten, die die traditionellen disziplinären Grenzen neu definieren. Es verbindet verschiedene Bereiche entlang der Wertschöpfungskette des Bauwesens, einschliesslich Ingenieurwesen, Recht, Architektur und Fertigung, mit dem Ziel, die derzeitigen Praktiken grundlegend zu überdenken und neue Kreislaufkonzepte in grossem Massstab einzuführen. Dieser Rahmen fördert die Zusammenarbeit, die Interoperabilität und die Gesamteffizienz als Schlüsselfaktoren für den systemischen Wandel.
SWIRCULAR ist eine effektive Lösung, mit der die hohen Risiken, Kosten, die Zersplitterung zwischen den Stakeholdern und die Komplexität der Projekte bewältigt werden können, die derzeit den Umstieg behindern.
Kunststoffrevolution made in Switzerland! Das Flagship-Projekt "Towards a NetZero Plastics Industry" mobilisiert führende Forschungseinrichtungen und Industriepartner, um die CO2-Emissionen radikal zu senken und eine effiziente Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu etablieren. Zur Erreichung dieses Ziels konzentriert sich die Forschung auf die Verbesserung von Materialien und Prozessen, die Steigerung der Wiederverwendung und das Recycling von Kunststoffen sowie die Förderung der Kooperation zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsakteuren. Die Initiative leistet einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Industrie und den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, insbesondere in den Bereichen verantwortungsvolle Produktion und Konsum (SDG 12) sowie Massnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). "Towards a NetZero Plastics Industry" veranschaulicht das Engagement der Schweiz für eine nachhaltige Zukunft und setzt neue Masstäbe für die globale Kunststoffindustrie.
Ausschreibung 2021:
1. Bewältigung der durch Covid-19 ausgelösten Beschleunigung des digitalen Wandels
2. Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit sowie Verringerung der Verwundbarkeit von Gesellschaft, Infrastruktur und Prozessen
Zukunftsweisende geothermische Systeme können das Schweizer Energiesystem durch die Bereitstellung von dekarbonisierter und dezentraler Heizwärme und Strom widerstandsfähiger machen. So wird das zunehmend auf Sonnen- und Windenergie basierende Schweizer Energieversorgungssystem konsolidiert und seine Resilienz verbessert. Das Flagship konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger und fortschrittlicher geothermischer Systeme. Ferner berücksichtigt es technisch-ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Aspekte sowie die Lebenszyklusbewertung aller Primärenergiequellen und ermöglicht auf diese Weise die Entwicklung geothermischer Systeme, die Ausarbeitung energiepolitischer Empfehlungen für die Schweiz und die Einführung neuer Energiegeschäftsmodelle.
Dieses Flagship befasst sich mit der Machbarkeit und der Verbesserung einer Kreislaufwirtschaft für Elektrofahrzeugbatterien. Um einen solchen Kreislauf zu schliessen, müssen zahlreiche Innovationen und transdisziplinäre Kooperationen in den verschiedenen Lebensphasen der Batterien entwickelt und umgesetzt werden. Dazu gehören die Ausweitung des Einsatzes in der ersten Nutzungsphase mit besseren Modellen zur Vorhersage der Batterielebensdauer und die Beseitigung der Hindernisse für die zweite Nutzungsphase von Elektrofahrzeugbatterien. Das Flagship befasst sich zudem mit der Verbesserung der wirtschaftlichen und technischen Leistung des Batterierecyclings, den Wiederaufbereitungstechnologien und dem Upcycling. Es bewertet die Brauchbarkeit recycelter Materialien in der Produktion von Batteriezellen und die Nachhaltigkeit dieses Prozesses.
Die Dekarbonisierung von Städten und Regionen ist eine der Herausforderungen, die zu bewältigen ist, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. In einem inter- und transdisziplinären Rahmen befasst sich das Flagship DeCIRRA mit den folgenden Fragen: Wie können wir Städte und Regionen dekarbonisieren? Wie können wir die lokalen Ressourcen und die vorhandene Infrastruktur optimal nutzen? Welche Rolle können Energieversorger und erneuerbare Gase bei der Umstellung auf ein Energiesystem ohne Netto-CO2-Emissionen spielen?
DeCIRRA ist eine Plattform, die viele Sektoren zusammenbringt und sich auf kritische Aspekte der Sektorkopplung und relevante Optionen der Produktion erneuerbarer Gase, einschliesslich Power-to-Gas, konzentrieren soll. Verglichen werden verschiedene Optionen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie biologisch negative Emissionen, da sie für das Erreichen des Netto-Null-Ziels erforderlich sind.
Kommunikation ist eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Der digitale Wandel und die Pandemie haben die digitale Kluft in Bezug auf den Zugang zu Information und Kommunikation für Menschen mit Behinderungen vergrössert. Ziel des Flagships ist es, IKT zu entwickeln, die diesen Zielgruppen den Zugang ermöglicht. Das Flagship ändert die Produktionsabläufe radikal: Bei Prozessen, die der Mensch bisher ausführte, wird ein Szenario mit menschlicher Unterstützung durch Maschinen eingesetzt. Halbautomatische Prozesse werden vollständig automatisiert. Die Ziele heissen Textvereinfachung, Übersetzung in Gebärdensprache, Bewertung der Gebärdensprache, Audiobeschreibung und gesprochene Untertitel.
Die praktische Ausbildung an Patientinnen und Patienten ist mit den heutigen Anforderungen und technischen Möglichkeiten nicht mehr vereinbar. Die meisten Schulungen dieser Art mussten während der Pandemie abgebrochen werden, was zu einer fast vollständigen Unterbrechung der chirurgischen Ausbildung führte. In diesem Flagship werden neuartige chirurgische Ausbildungsprogramme definiert und innovative Ausbildungskomponenten entwickelt, die von Online-Simulationen, Augmented-Box-Trainern und High-End-Simulatoren bis hin zu Augmented-Reality-fähigen offenen Operationen und immersiver Fernteilnahme im Operationssaal reichen, um sowohl in der Schweiz als auch im Ausland neue Massstäbe zu setzen.
Gebäude gehören zu den Hauptquellen von CO2-Emissionen in der Schweiz. Der Altbaubestand dürfte noch mehrere Jahrzehnte lang den überwiegenden Teil des Energiebedarfs dieses Sektors ausmachen. Die Herausforderungen bei gross angelegten und effizienten Nachrüstungsmassnahmen sind zahlreich, eng verstrickt und interdisziplinär. Das RENOWAVE-Flagship befasst sich mit der Gebäudesanierung in einem Prozess der Ko-Konstruktion zwischen Forschern aus verschiedenen Bereichen und unterschiedlichen Umsetzungspartnern, die an der komplexen Prozesskette der Sanierung beteiligt sind.
Der Tourismus ist ein globales Phänomen: Die Pandemie hat den Sektor in der Schweiz sehr hart getroffen. Die Pandemie beschleunigte den unvermeidlichen digitalen Wandel, dem sich der Sektor stellen muss, um das lokale Angebot und die internationale Nachfrageverteilung zu optimieren. Dieses Flagship wurde entwickelt, um proaktiv auf die Herausforderungen des digitalen Wandels zu reagieren. Zu diesem Zweck wird der Tourismussektor im Allgemeinen mit zuverlässigen Daten, neuen Geschäftsmodellen, Prozessen, Erfahrungen und Instrumenten für die Gestaltung widerstandsfähiger Tourismussysteme ausgestattet, während die gegenseitige Befruchtung von Praxisgemeinschaften gefördert wird.
Während die Automatisierung fortschreitet und die Qualifikationslücken wachsen, findet die Wertschöpfung in der Berufsausbildung zunehmend ausserhalb der Schweiz statt. Das Flagship strebt daher eine Kreislaufwirtschaft für Fertigkeiten und Kompetenzen an. Die Initiative soll es Einzelpersonen ermöglichen, einen fairen Zugang zu Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen zu erhalten und zukunftssichere Kompetenzportfolios zu entwickeln. Unternehmen erhalten eine Plattform, um Qualifikationslücken zu erkennen und zu schliessen, und Bildungsanbieten werden nachhaltige Schulungskonzepte und ein neuer Zugang zur Kurserstellung angeboten.
Die Pandemie hat nicht nur die Notwendigkeit des digitalen Wandels im schweizerischen Gesundheitswesen aufgezeigt. Eine Vielzahl technologischer Lösungen stösst auf uneinheitliche Datensilos, mangelnde Verantwortung und ineffiziente Organisationen. Am Beispiel von Spitälern zeigt dieses Flagship, wie die digitale Transformation mit Partnern aus der Industrie auf der Grundlage einer neuartigen Technologie-, Daten- und Wissensplattform umgesetzt werden kann. Das Flaggschiff soll diese Plattform nutzen, um einen Plan für die Digitalisierung des Gesundheitswesens insgesamt zu schaffen.
Die Städte leiden unter zu starkem Verkehr, der zu Luftverschmutzung und Lärmbelastung führt. Die zunehmende Beliebtheit des elektronischen Handels verschärft diese Herausforderungen. Das Flagship zielt darauf ab, ein urbanes Logistikkonzept für morgen zu entwickeln, das nachhaltig, widerstandsfähig und stadtfreundlich ist. Es reduziert auch den Bedarf an Güterverkehr in den Städten, indem es sich auf die Zustellung und Rücksendung von Paketen und anderen Waren konzentriert und gleichzeitig die Lebensqualität der Stadtbewohner erhöht. Mit dem Flagship wird ein sogenannter «co-opetitive» Ansatz eingeführt, bei dem die Wettbewerber in einem intelligenten städtischen Multihub natürlich zusammenarbeiten und mit einem White-Label-Konzept Pakete liefern. Die Effizienz der Logistik erhöht sich durch die Bündelung der Tätigkeiten und reduziert gleichzeitig Kosten, gefahrene Kilometer und CO2-Emissionen.
Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur die Anfälligkeit der Gesellschaft für Infektionen gezeigt, sondern auch ihre Fähigkeit, darauf zu reagieren. Das SwissPandemic AMR-Health Economy Awareness Detect Flagship soll die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um die sich stetig ausweitende, stille Pandemie der antimikrobiellen Resistenz (AMR) mit potenziell 10 Millionen Todesfällen pro Jahr weltweit bis 2050 anzugehen. Das Flagship nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für die Risikoanalyse und -stratifizierung zusammen mit optimierter, zeitnaher Diagnostik und Berichterstattung sowie verstärkter, direkter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, um kosteneffiziente Lösungen für AMR in vielen verschiedenen klinischen Bereichen zu verbessern. Optimale Praktiken sollen die systemische Widerstandsfähigkeit gegenüber neu auftretenden Infektionen erhöhen.
Um den Herausforderungen zu begegnen, die sich aus der zunehmenden Prävalenz neurologischer Erkrankungen in einer alternden Gesellschaft ergeben, soll das Flagship SWISSNEUROREHAB ein effektives und effizientes Modell für die Neurorehabilitation im Pflegekontinuum entwickeln und validieren. Dieses Modell spezifiziert den klinischen, operationellen und wirtschaftlichen Bedarf an Behandlungen von sensomotorischen und kognitiven Defiziten nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Traumata und Rückenmarksverletzungen. Therapeutische Programme, die durch digitale Behandlungen unterstützt werden, sollen von Schweizer Kompetenzzentren validiert und in die klinische Routine integriert werden. Ein interkantonales ökonomisches Modell wird die Übernahme der Kosten des neuen Modells im Schweizer Gesundheitssystem bestätigen und die Rentabilität für Gesundheitsdienstleister und Medizintechnikunternehmen abschätzen.
Der Grossteil der Weltbevölkerung lebt in Städten, die in hohem Masse zur Verschmutzung und damit zur Klimakrise beitragen. Das Blue City Project ist ein transdisziplinäres Konsortium, das sich zum Ziel gesetzt hat, die vielschichtigen, vernetzten Abläufe einer Stadt zu kartieren und einen reaktionsfähigen städtischen «digitalen Zwilling» zu entwerfen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz und datenorientierten Darstellungen unterstützt diese offene Plattform die Bürger bei evidenzbasierten, kollektiven Entscheidungen, um das Wohlbefinden, die Nachhaltigkeit, die Widerstandsfähigkeit und den ökologischen Wert des urbanen Raums zu verbessern. Eine solche Plattform könnte die Branchen entlang der Wertschöpfungsketten von Immobilien, Design und Stadtverwaltung revolutionieren.
Das WISER-Flagship schlägt eine systemische Innovation für die Schweiz vor: Weltmarktführerin auf dem Gebiet der Umweltbuchhaltung zu werden. Auf der Basis von Transparenz, Rechenschaftspflicht und den Stärken der Schweizer Forschung soll ein digitales Ökosystem geschaffen werden, in dem öffentliche und private Akteure ihr Wissen über Treibhausgase einbringen und austauschen können. Das Flagship macht unterschiedliche Datenquellen und -systeme vergleichbar, verständlich und überprüfbar und schafft damit die Grundlage für gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Dekarbonisierungsbemühungen. Es bietet Bewertungsrahmen und massgeschneiderte Visualisierungstools, welche die Analyse der CO2-Bilanz von Lieferketten erleichtern.
Letzte Änderung 13.06.2024
Kontakt
Flagship Initiative
Kathrin Kramer
Marc Gerber
Winnie Schluep
Tel.: +41 58 469 20 04
Audit und Assurance
+41 58 463 22 92
E-Mail